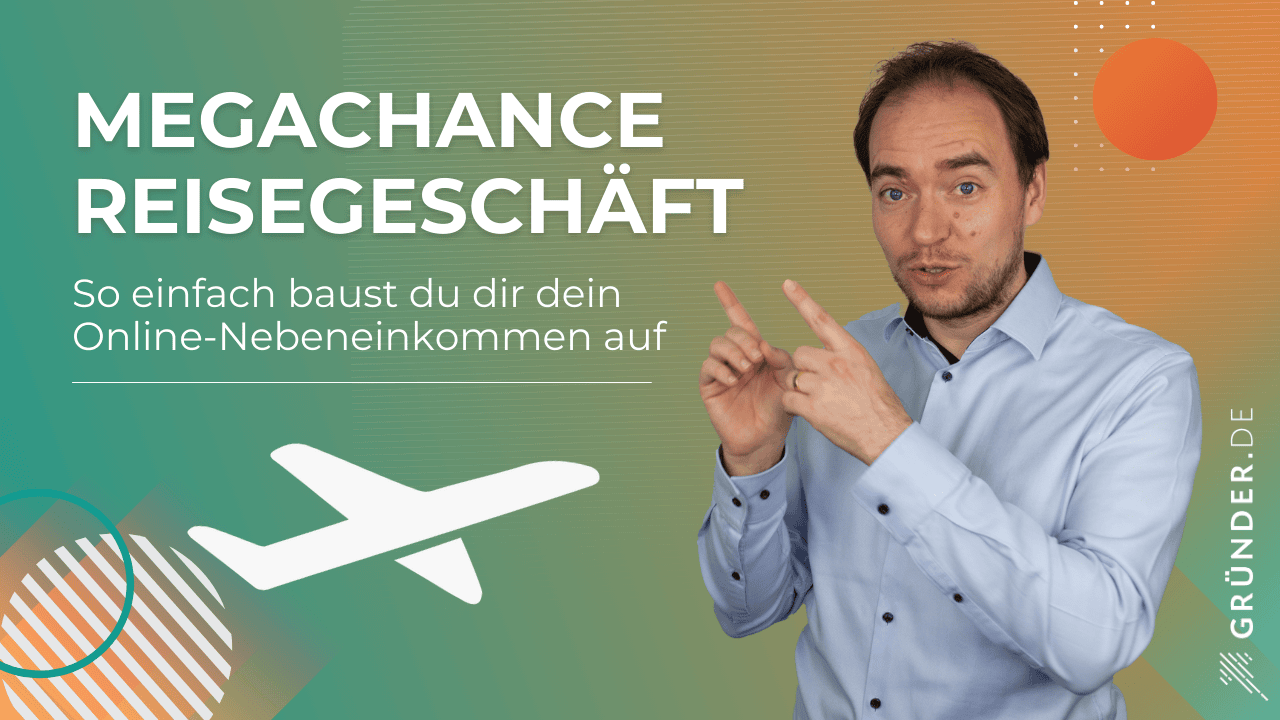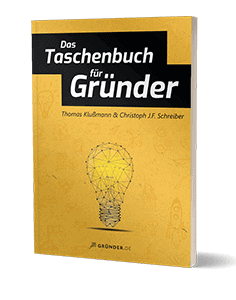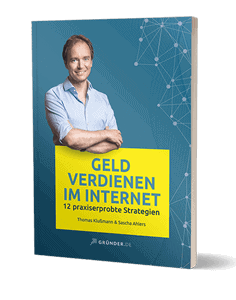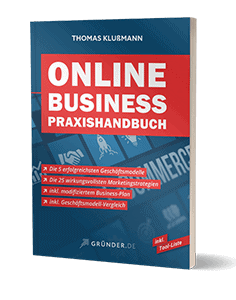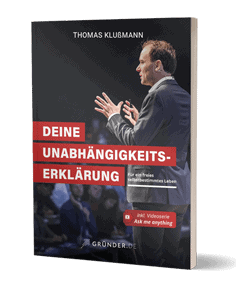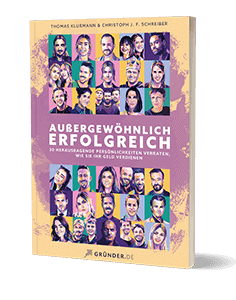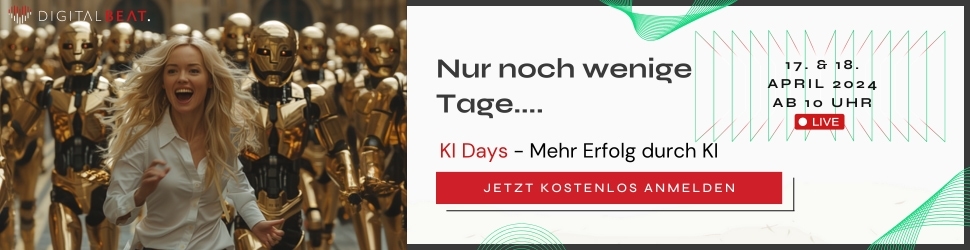Gründer FAQ: Was Unternehmer über Allgemeine Geschäftsbedingungen wissen sollten
Was sind AGB und wann sind sie wirksam?
 Andreas Fricke und Luisa Kleinen
| 20.11.2023
Andreas Fricke und Luisa Kleinen
| 20.11.2023
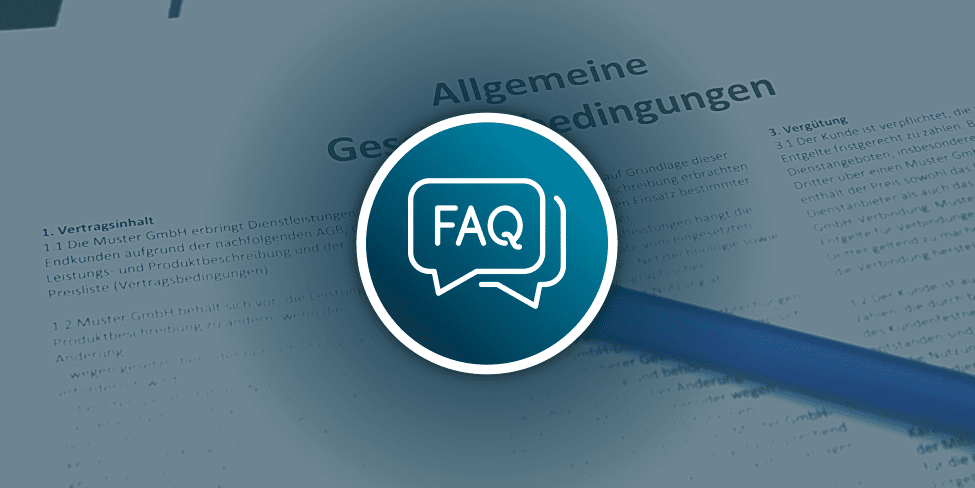
Featured image: eccolo - stock.adobe.com
AGB werden bei Vertragsabschlüssen sehr häufig verwendet. Wir zeigen dir deshalb, wie du überprüfen kannst, ob deine AGB wirksam sind.
Inhaltsverzeichnis
- Definition: Was sind AGB?
- Benötige ich als Unternehmer AGB?
- Müssen AGB als solche bezeichnet werden?
- Wann sind AGB wirksam?
- Was sind Klauseln in den AGB, die den Vertrag unwirksam machen?
- Was sind die Folgen nicht wirksamer bzw. rechtswidriger AGB-Klauseln?
- Häufige Fragen (FAQ) zu: Was sind AGB und wann sind sie wirksam?
Gesamtes Inhaltsverzeichnis anzeigen
Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen häufig Vertragsangeboten bei und spielen im heutigen Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle. Tatsächlich wissen nur Wenige, was sich dahinter eigentlich genau verbirgt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vertragsbestimmungen. Umgangssprachlich werden AGB daher oft auch „das Kleingedruckte“ genannt. Wer AGB vorlegt, will damit erreichen, dass die Regelungen, die dort enthalten sind, Inhalt des Vertrags werden. Enthalten deine AGB unwirksame Klauseln, drohen übrigens Abmahnungen von Konkurrenten oder Vereinen. Mit unseren Tipps kannst du deine Verträge prüfen und erfährst dadurch rechtzeitig, welche deiner AGB nicht wirksam oder gar verboten sind.
Definition: Was sind AGB?
Das Bürgerliche Gesetzbuch, kurz BGB, definiert in § 305 Abs. 1 BGB AGB als „… für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt.“ Individuelle Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien sind hingegen keine AGB. Unter Vertragsbestimmungen, sind Bestimmungen zu verstehen, die Inhalt des Vertrags werden sollen.
Bestimmte Bereiche werden regelmäßig durch AGB geregelt, wie beispielsweise:
- Gerichtsstand
- Gewährleistungen
- Lieferbedingungen
- Nutzungsrechte
- Zahlungsbedingungen
Wie heißt es richtig: AGBs, AGB’s oder AGB?
Die korrekte Abkürzung für Allgemeine Geschäftsbedingungen lautet „AGB“. Denn der Begriff beinhaltet bereits den Plural. Ein Plural-„s“ und auch ein Apostroph sind mithin absolut überflüssig.
Verwechslungsgefahr: AGB und Pflichtinformationen
Bei der Frage „Was sind AGB?“ sind sie nicht zu verwechseln mit Pflichtinformationen. Pflichtinformationen sind gesetzlich vorgeschriebene Informationen, die vor allem Verbrauchern kurz vor oder bei Vertragsschluss vorzuzeigen sind. AGB hingegen sind nicht verpflichtend. Allerdings werden oft relevante Informationen mit AGB zusammen in ein Dokument gefasst.
Welche Sprache für AGB verwenden?
AGB sind immer in der Vertragssprache zu formulieren. Wer also einen Onlineshop in mehreren Sprachen betreibt muss in allen angeboten Sprachen auch AGB zu Verfügung stellen.
Benötige ich als Unternehmer AGB?
Grundsätzlich gilt: AGB sind keine Pflicht! Wenn du mit den gesetzlichen Regelungen zufrieden bist, dann benötigst du keine AGB. Werden keine solchen Regeln verwendet, so gelten übrigens schlicht die gesetzlichen Regelungen. Allerdings sind AGB häufig sehr sinnvoll. Denn AGB dienen dem Zweck, Geschäftsvorgänge zu vereinheitlichen und gesetzliche Regelungen abzuändern. Dadurch wird einerseits die firmeninterne Organisation vereinfacht und zugleich werden Kosten eingespart.
Es gilt zu bedenken: Gesetze sind abstrakt und dadurch nicht immer klar in ihrer Bedeutung. Somit spiegeln sie nicht immer die gewünschten Vertragsergebnisse wieder. AGB helfen den Vertrag den Wünschen der stellenden Vertragspartei anzupassen.
Was sind AGB zur Abwehr von AGB des Vertragspartnern?
Schließt du als Unternehmer mit anderen Unternehmen Verträge, so sind eigene AGB zur Abwehr der AGB der Vertragspartner sinnvoll. Sie ersparen so das Verhandeln von nachteiligen Klauseln und schützen dich auch, wenn du die AGB des Vertragspartners nicht liest. Das empfiehlt sich besonders dann, wenn du als Unternehmer im kreativen Bereich tätig bist.
Eine allgemeine Klausel wie: „Den AGB des Vertragspartners wird widersprochen.“, ist allerdings sehr unvorteilhaft. Enthalten die AGB deines Vertragspartners eine Klausel mit der gleichen Aussage, so hat dies schlicht zur Folge, dass die Klauseln jeweils entfallen. Dass heißt, es gelten weiterhin die AGB des Vertragspartners und ihr müsst in einem komplizierten Prozess abwägen, welche Klauseln weiterhin gelten.
Müssen AGB als solche bezeichnet werden?
Es gibt kein Gesetz, dass vorschreibt, dass AGB auch als solche bezeichnet werden müssen. Aus rechtlicher Sicht ist die Bezeichnung der AGB somit irrelevant. Im Hinblick auf die Frage „Was sind AGB?“ bedeutet das: Auch AGB, die nicht AGB heißen, werden rechtlich regelmäßig als solche bewertet. Die Bezeichnungen für Allgemeine Geschäftsbedingungen variieren stark nach Branche.
Typische Bezeichnungen für AGB lauten etwa:
- AGB bzw. Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Nutzungsbedingungen
- Richtlinien
- Hausordnung
- Rahmenvertrag
- Geschäftsbedingungen
- Teilnahmebedingungen
- Reparaturhinweise
- Wichtige Hinweise
- Vertrag
Wann sind AGB wirksam?
AGB sind allgemein nur dann wirksam, wenn sie Bestandteil des Vertrages wurden und sie nicht gegen gesetzliche Beschränkungen verstoßen. Dazu muss man zunächst zwischen Verträgen mit Verbrauchern und Verträgen mit Unternehmern unterscheiden.
Wann werden AGB wirksam in einen Verbraucher-Vertrag (B2C) einbezogen?
Du als Unternehmer bist verpflichtetet Verbraucher, die mit dir einen Vertrag abschließen, deutlich auf deine AGB hinzuweisen. Man spricht juristisch von der sog. Hinweispflicht. Hierbei empfiehlt es sich, sehr gründlich zu sein. Leitest du ein Geschäft solltest du deutlich sichtbar einen Aushang, bestenfalls im Kassenbereich, aushängen.
Verbraucher müssen sich mit den AGB einverstandenen erklären. Dazu reicht eine entsprechende Aussage am Telefon oder in einer E-Mail. In Geschäften reicht es aus, den Aushang zu platzieren, dass ein durchschnittlicher Verbraucher ihn bei seinem Einkauf bzw. kurz davor wahrnehmen kann. Bei Online-Geschäften ist Hinweispflicht genüge getan, wenn die AGB in unmittelbarer Nähe der Bestellabschluss-Schaltflächen platziert werden. Dazu reicht ein kurzer Satz wie zum Beispiel: „Sie erklären sich mit unseren AGB einverstanden“. Ein Kontrollkästchen ist grundsätzlich nicht erforderlich.
Des weiteren musst du einem Verbraucher spätestens mit der Zusendung der Ware bzw. dem Ausführen der Dienstleistung deine AGB vorlegen und zwar in dauerhafter Form, sprich via E-Mail oder in Papierform. Aber Achtung: Der Hinweis auf die AGB muss spätestens mit Vertragsabschluss erfolgen.
Wann werden AGB wirksam in einen Vertrag zwischen Unternehmen (B2B) einbezogen?
Bei Verträgen zwischen Unternehmern gelten keine speziellen Vorgaben hinsichtlich der Einbeziehung der AGB in den Vertrag. Hierbei bei solltest du allein darauf achten, dass ein objektiver, typischer Unternehmer an Stelle des Vertragspartners die Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hätte erkennen können. Zwischen Unternehmern ist zudem ein Link zu den AGB ausreichend. Auf Nummer sicher gehst du allerdings, wenn du dich auch hierbei an den Regeln, die für Verbraucher gelten, orientierst.
Was sind Klauseln in den AGB, die den Vertrag unwirksam machen?
AGB-Klauseln können auch unwirksam sein, wenn sie wirksam in den Vertrag einbezogen wurden. Das ist der Fall, wenn die Klausel:
- überraschend ist,
- gegen gesetzliche Verbote verstößt oder
- unangemessen ist.
Was sind überraschende Klauseln der AGB?
Ist eine Klausel so ungewöhnlich, dass man mit ihr nicht rechnen musste, so handelt es sich um eine überraschende bzw. überrumpelnde Klausel. Entscheidend sind hierbei die Umstände des Einzelfalls. Gerade mit Blick auf Verbraucher sind Gerichte hier erfahrungsgemäß der Bewertung streng.
Ein typisches Beispiel für eine überraschende Klausel sind sog. Abo-Fallen. Eine Abo-Falle liegt vor, wenn ein Anbieter auf seiner Website den Eindruck erweckt, kostenlose Dienste zu Verfügung zu stellen. In Wirklichkeit handelt es sich dabei allerdings um ein kostenpflichtiges Abonnement. Sollte dies allein in den AGB festgelegt sein, so ist die AGB-Klausel nicht wirksam. Denn die Höhe des Entgeltes für ein Produkt oder einen Dienst wird nicht in den AGB erwartet.
AGB-Klausel verstößt gegen das Gesetz
Das BGB enthält in den §§ 307 ff. BGB einen Katalog an verbotenen Regelungen. Dieser Katalog ist sehr umfangreich und sollte daher vor dem Erstellen der AGB genau in Augenschein genommen werden, um nicht in die Falle zu tappen. Allerdings gelten die festgeschriebenen Verbote nur für Verträge zwischen Verbrauchern.
Unangemessene AGB-Klauseln
Ob eine Klausel angemessen ist oder nicht, wird anhand der sog. Inhaltskontrolle gem. § 307 BGB ermittelt. Es wird überprüft, ob die Klausel intransparent ist, wesentliche Vertragspflichten beschränkt, sodass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, oder einen wesentlichen Grundgedanken des Gesetzes entgegen steht. Hierbei kann es durchaus vorkommen, dass eine Klausel gleich aus mehreren Gründen unwirksam ist.
Solltest du dir nicht sicher sein, ob eine deiner Klauseln unangemessen ist, so ist es ratsam dich rechtlich beraten zu lassen. Für Juristen gehört die AGB-Kontrolle quasi zum rechtlichen 1×1 und wird daher bereits zu Beginn des Studiums unterrichtet.
Was sind die Folgen nicht wirksamer bzw. rechtswidriger AGB-Klauseln?
Ist eine Klausel unwirksam, so entfällt sie automatisch und es gilt das Gesetz, vgl. § 306 Abs. 2 BGB. Eine Umdeutung der Klausel in eine wirksame ist rechtlich unzulässig und mithin nicht möglich. Sofern nur ein Teil einer Klausel unwirksam ist, wird geprüft, ob der verbleibende Rest noch sinnvoll, verständlich und vernünftig ist. Diese Methode wird als sog. Blue-Pencil-Test bezeichnet.
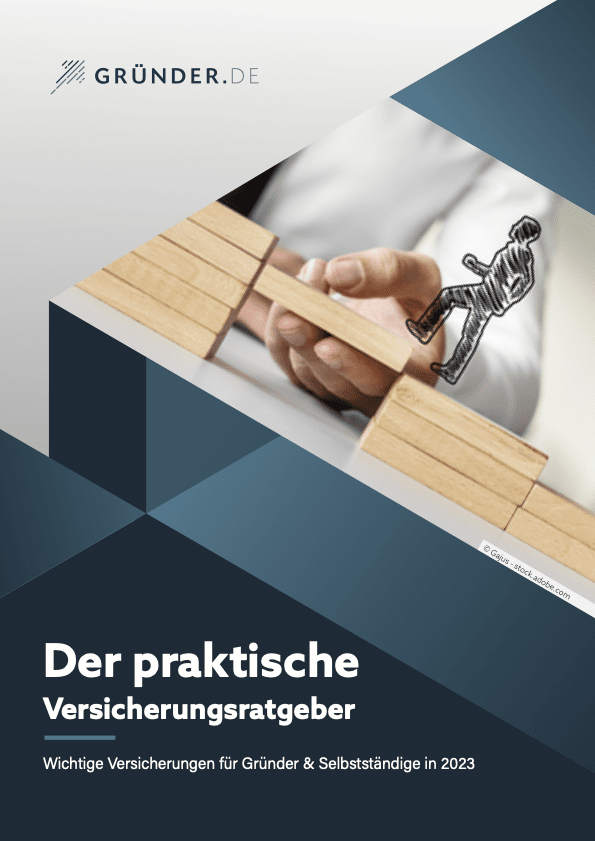
eBook
7 Versicherungen die du als Gründer wirklich brauchst
Mit unserem eBook behältst du den Blick auf das Wesentliche – vergiss alles andere!
Häufige Fragen (FAQ) zu: Was sind AGB und wann sind sie wirksam?
Allgemeine Geschäftsbedingungen, kurz AGB, sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Individualabreden sind hingegen keine AGB.
AGB regeln für Gewöhnlich Liefermöglichkeiten und Zahlungsbedingungen, aber auch Folgen eines Liefer- oder Zahlungsverzugs sowie Haftungsbeschränkungen.
AGB gelten als Vertragsbestandteil, wenn sie Wirksam in den Vertrag einbezogen wurden. Dafür ist häufig ein ausdrücklicher Hinweis des Verwenders notwendig. Die Einverständniserklärung ausdrücklich, aber auch durch schlüssiges Verhalten erfolgen.
Eine AGB-Klausel ist nicht wirksam, wenn sie den Vertragspartner überrascht, unangemessen benachteiligt oder gegen ein Verbot der §§ 308, 309 BGB verstößt. Auch intransparente Klauseln nicht unwirksam.
Die §§ 307 ff. BGB regeln, welche AGB verboten sind. Dazu zählen beispielsweise Klauseln, die eine Haftung für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einschränken, vgl. § 309 Nr. 7 BGB.
Regelmäßig finden sich salvatorische Klauseln am Ende eines Vertrags und lauten wie folgt: “Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende, wirksame Regelung zu treffen.” Diese Klausel-Art ist genau genommen überflüssig, weil § 306 BGB genau diesen Fall regelt.

Wie verhalte ich mich bei einer markenrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Abmahnung?
Du weißt nicht, wie du mit einer markenrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Abmahnung umgehen sollst? In unserem Artikel findest du hilfreiche Tipps.
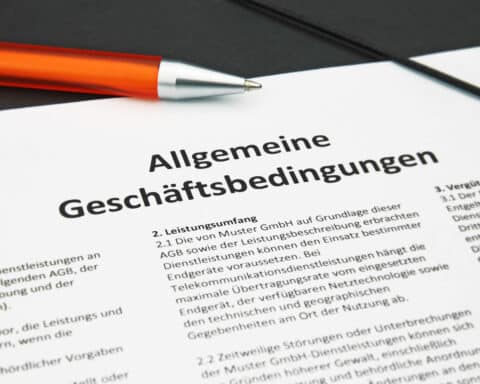
AGB erstellen: Welche Gesetze gelten für die Geschäftsbedingungen?
AGB erstellen leicht gemacht - unser Überblick bietet alle Details zu den gesetzlichen Vorgaben, Kosten und wichtigsten Inhalten.

Was muss alles ins Impressum?
Wo muss man das Impressum verlinken? Wir erklären dir, worauf du beim Erstellen des Impressums achten musst.

Impressum-Generator: So wird deine Website rechtssicher
Um deine Website rechtssicher zu gestalten, solltest du ein Impressum erstellen. Dies gelingt dir schnell und einfach mithilfe eines Impressum-Generators.
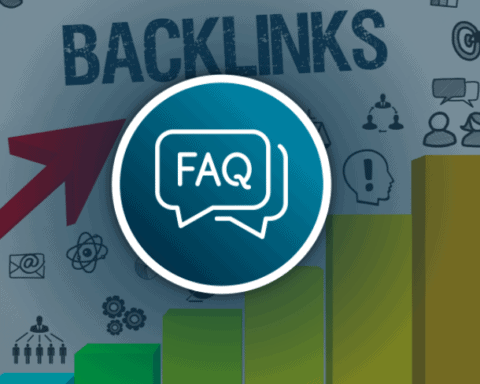
Backlinks für die Suchmaschinenoptimierung nutzen: Was ist Rechtliches zu beachten?
Backlinks stärken die SEO-Werte. Aber was muss Rechtliches dabei beachtet werden? Die Antwort gibt Rechtsanwalt Christian Solmecke!

Firmenrechtsschutzversicherung: So sicherst du dich rechtlich ab
Eine Firmenrechtsschutzversicherung bietet, wie eine Rechtsschutzversicherung, Schutz vor juristischen Streitigkeiten - nur eben für Unternehmen und Firmen.

Rechtliche Voraussetzungen bei der Unternehmensgründung: Die 10 fatalsten Fehler
Manche Fehler können dich das ganze Unternehmen kosten. Diese rechtlichen Voraussetzungen solltest du daher unbedingt beachten!
DU willst deine KI-Skills aufs nächste Level heben?
WIR machen dich bereit für die Revolution
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ!
- Praxisbeispiele – sofort anwendbar für dein Business
- Aktuelle KI-Tools im Check
- Expertentipps für die neusten KI-Technologien
- Case Studies – von E-Mail-Marketing bis Datenanalyse
Ja, ich möchte den Newsletter. Die Einwilligung kann jederzeit im Newsletter widerrufen werden. Datenschutzerklärung.
Über den Autor

Andreas Fricke
Andreas war von März 2022 bis Februar 2024 in der Redaktion von Gründer.de. Hier verantwortete er die Bereiche Franchise- und Gründer-Verzeichnis, außerdem arbeitet er regelmäßig an neuen Büchern und eBooks auf unserem Portal. Zuvor hat er 5 Jahre lang in einer Online-Marketing-Agentur für verschiedenste Branchen Texte geschrieben. Sein textliches Know-how zieht er aus seinem Studium im Bereich Journalismus & Unternehmenskommunikation.